Fördermittelprogramme für die Lüneburger Innenstadt
Auf Krisen reagieren und für die Zukunft fit machen
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch in der Lüneburger Innenstadt zu spüren. Um die Innenstadt zu beleben und sie attraktiv zu halten, ergreift die Hansestadt Lüneburg eine Reihe von Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung.
So hat sie drei Förderrichtlinien für den Innenstadtbereich aufgelegt, mit denen zum Beispiel Neuanmietungen, Neuausstattungen von Geschäftsräumen, Digitalisierungsprojekte und das Schaffen von Wohnraum gefördert werden.
Darüber hinaus beantragt die Hansestadt Lüneburg Fördermittel aus vier Programmen, die aus EU/EFRE-Mitteln vom Land Niedersachsen und vom Bund aufgelegt wurden:

Die Lüneburger Innenstadt. Foto: Hansestadt Lüneburg
Hansestadt Lüneburg
Nachhaltige Stadtentwicklung
Finn Kubisch
+49 4131 309-3163
E-Mail senden
Oliver Bruns
+49 4131 309-3164
E-Mail senden
Florian Norbisrath
+49 4131 309-3165
E-Mail senden
Resiliente Innenstadt Lüneburg
Die Innenstadt behutsam umgestalten
Seit der Bescheidübergabe durch Birgit Honé, ehemalige Niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, ist es offiziell: Die Hansestadt Lüneburg ist eine von landesweit 15 Städten, die in das Landes-Fördermittelprogramm „Resiliente Innenstädte“ aufgenommen wurde.
Das Programm zielt auf eine behutsame Umgestaltung der Innenstädte ab, Frau Honé fasst zusammen: „Wir unterstützen Lüneburg mit dem Programm bei der behutsamen und nachhaltigen Umgestaltung der Innenstadt. Es geht uns darum, mehr Leben und Nutzungsvielfalt in die Städte zu bringen, klima- und umweltgerechte Mobilitäts- und Flächenkonzepte zu fördern und die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen“. Hierfür stehen bis 2027 nun insgesamt 6,6 Millionen Euro zur Verfügung, wovon 60 Prozent (3,95 Millionen Euro) zur Förderung beantragt werden können.

Lüneburg ist drin im Programm Resiliente Innenstädte – über den offiziellen Bescheid von der damaligen Regionalministerin Birgit Honé (M.) freuen sich Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch und Finn Kubisch aus der Stabsstelle Nachhaltige Stadtentwicklung auf dem Marienplatz. Foto: Hansestadt Lüneburg


Hansestadt Lüneburg
Nachhaltige Stadtentwicklung
Finn Kubisch
+49 4131 309-3163
E-Mail senden
Oliver Bruns
+49 4131 309-3164
E-Mail senden
Florian Norbisrath
+49 4131 309-3165
E-Mail senden
Sofortprogramm Perspektive Innenstadt
Landesfördermittel, um den Folgen der Pandemie zu begegnen
Mit 117 Millionen Euro unterstützt das Land Niedersachsen die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pandemie. Auch die Hansestadt Lüneburg profitiert von diesem Fördermittelprogramm und setzt in diesem Rahmen verschiedenste Maßnahmen um. So wird beispielweise weiteres Stadtmobiliar beschafft oder der Glockenhof erneuert, um die Aufenthaltsqualität sofort zu erhöhen. Durch ein Innenstadtmanagement und die Erstellung eines Strategiekonzepts wird außerdem ein wesentlicher Grundstein gelegt, um die Lüneburger Innenstadt auch zukünftige lebendig und lebenswert zu gestalten. Hierfür steht ein Volumen von insgesamt 2,15 Millionen Euro zur Verfügung, welches zu 1,9 Millionen Euro gefördert wird.
Möglich wird dies durch die EU-Aufbauhilfe REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), aus welchem die Mittel stammen. Das Fördermittelprogramm wird als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert.
Das Programm richtet sich an von der Corona-Pandemie erheblich betroffene Kommunen. Ziel ist es, neue Nutzungen und die Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Innenstädten zu ermöglichen, Beiträge zur Digitalisierung und Klimaschutz zu leisten und der Gefahr einer zunehmenden Verödung der Innenstädte entgegen zu wirken.
Durch die bereitgestellten Fördermittel haben die Kommunen die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Verkehrskonzepte oder innovative Nach- oder Zwischennutzungsprojekte in sechs breit aufgestellten Handlungsfeldern zu initiieren.
Weitere Infos zum Programm finden Sie auf der Seite des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung.
Bis Mitte Juli 2021 konnten niedersächsische Städte und Gemeinden Anträge für die Aufnahme in das Programm stellen. Am 7. September 2022 wurde dann auch der Hansestadt Lüneburg der Bescheid über die Aufnahme in das Programm ausgestellt. Hierdurch stehen Fördermittel von 1,9 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Eigenanteil von rund 250.000 Euro steigt das Gesamtvolumen auf 2,15 Millionen Euro. Erstmals hat der Rat der Hansestadt Lüneburg im Oktober 2022 ein Maßnahmenpaket beschlossen, das umgesetzt werden soll. Im vergangenen Jahr hat es dabei kleinere Änderungen bei den Maßnahmen gegeben, so dass aktuell zwölf Maßnahmen in der Planung und Umsetzung oder aber bereits abgeschlossen sind.
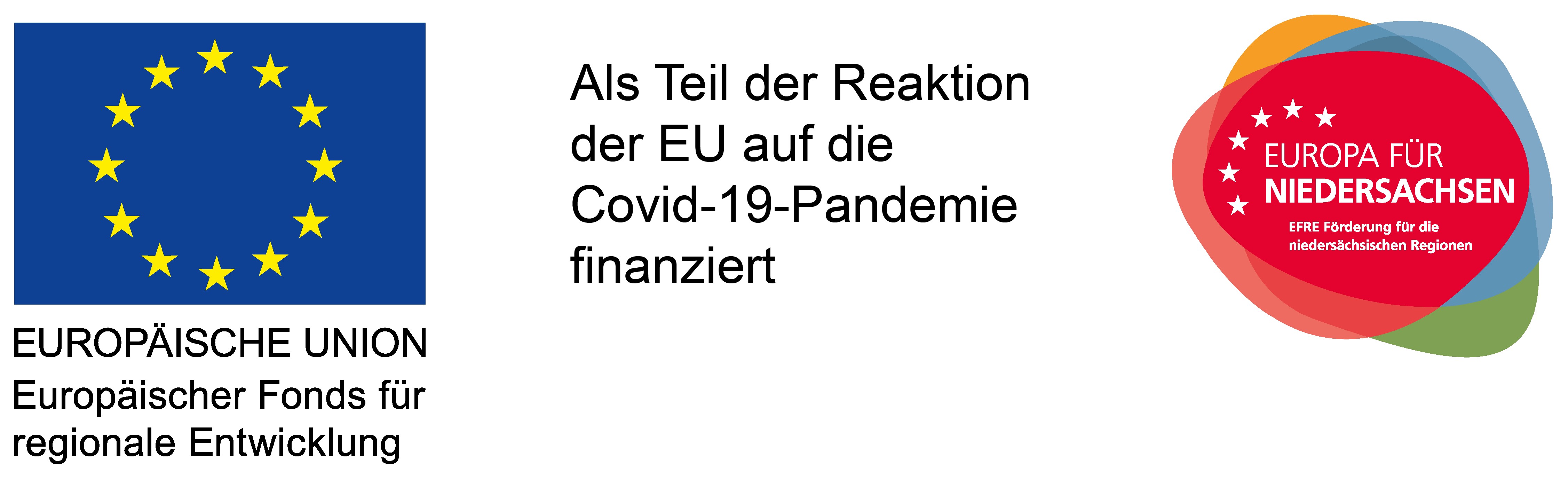
Hansestadt Lüneburg
Nachhaltige Stadtentwicklung
Finn Kubisch
+49 4131 309-3163
E-Mail senden
Oliver Bruns
+49 4131 309-3164
E-Mail senden
Florian Norbisrath
+49 4131 309-3165
E-Mail senden
Stadtlabore für Deutschland
Leerstand und Ansiedlung
Im Rahmen des Projekts „Stadtlabore für Deutschland: Leerstand und Ansiedlung“ hat das IFH KÖLN gemeinsam mit 14 Modellstädten unterschiedlicher Größe aus ganz Deutschland ein digitales Tool für proaktives Ansiedlungsmanagement in Innenstädten erarbeitet und damit die Basis für ein dialogorientiertes, standardisiertes Miteinander im Prozess der Vitalisierung von Stadtzentren geschaffen. Neben dem digitalen Tool standen das Lernen der einzelnen Innenstadtakteur:innen voneinander und das Generieren der richtigen Daten für die Zukunftsplanung im Vordergrund. Das Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, das mit Mitteln des Bundes (zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes) gefördert wurde, umfasste ein Gesamtvolumen von rund 11,9 Millionen Euro und endete im Dezember 2022. Zu den weiteren beteiligten Kommunen neben der Hansestadt Lüneburg zählen: Bremen, Erfurt, Hanau, Karlsruhe, Köln, Langenfeld, Leipzig, Lübeck, Mönchengladbach, Nürnberg, Rostock, Saarbrücken, Trier und Würzburg.
Die Organisation und Koordination des Vorhabens lag bei der IFH KÖLN GmbH, die als Antragstellerin die Modellstädte mit ihren Anforderungen und Dienstleister zusammenbrachte. Die Modellkommunen erhielten eine 100-prozentige Erstattung der Projektkosten. Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Stadtlabore für Deutschland zu finden.
Das übergeordnete Ziel des Vorhabens ist, eine digitale Lösung für aktives Ansiedlungsmanagement in deutschen Städten/Kommunen zu entwickeln und zu verproben. Dafür bedarf es standardisierter Prozesse, Abläufe und Tools, um eine qualitative Nachvermietung zu ermöglichen. Zudem wird ein ganzheitlicher Überblick zu aktuellen Leerständen, Immobilienstruktur, angebotenen Verkaufsflächen, aber auch passenden Anbietern benötigt. Entsprechend hat die digitale Plattform als technische Basis als Adressaten zum einen Städte/Kommunen, zum anderen die Immobilienbesitzer, Makler und Anbieter. Nach einer im Netzwerk „Die Stadtretter“ initiierten Umfrage bei deutschen Kommunalverwaltungen wollen 84 Prozent der etwa dreihundert befragten Kommunen zukünftig Eigentümer aktiv bei der Nachvermietung und Nachnutzung ihrer Immobilien unterstützen. Diese Innenentwicklung mit ihrer im Baugesetzbuch verankerten Maßgabe „Innen vor Außen“ liefert zudem einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme, die in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung verankert ist.
Um Leerstandsmanagement zu betreiben und Innenstadtlagen eine Zukunftsfähigkeit zu ermöglichen, sie also so zu entwickeln, dass sie sowohl gesellschaftliche Teilhabe für BürgerInnen sowie Wohlfahrt und Wohlstand für die urbane Gesellschaft als auch Raum für tragfähige Geschäftsmodelle bieten, braucht es neue Ansätze zur Kontrolle und Steuerung. Für eine aktive Innenentwicklung und das Leerstandsmanagement fehlen jedoch die digitalen Instrumente, wie ein Workshop mit 20 Kommunen zeigte: 18 der 20 teilnehmenden Kommunen erfassen Leerstand über Excellisten o. ä. So zeigt sich die Notwendigkeit, diese Verwaltungsleistung in Kommunen zu verankern und gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG) auf elektronischem Weg auch für Immobilieneigentümer nutzbar zu machen.
Das Ziel des vorliegenden Vorhabens ist, durch einen ganzheitlichen Überblick zu aktuellen Leerständen, Immobilienstruktur, angebotenen Verkaufsflächen, aber auch passenden Anbietern ein proaktives Ansiedlungsmanagement zu schaffen. Dafür bedarf es standardisierter Prozesse, Abläufe und Tools, um eine qualitative Nachvermietung zu ermöglichen. Daher wird durch die Entwicklung einer digitalen Lösung/Plattform die technische Basis gelegt, die als Adressaten zum einen Städte/Kommunen, zum anderen die Immobilienbesitzer, Makler und Anbieter hat. Das Matching von Angebot und Nachfrage geschieht durch einen Algorithmus, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Im Vergleich zu Immobilien-Plattformen im Internet werden viel mehr Daten involviert sein, die eine wesentlich bessere Entscheidungs- und damit auch Matchingqualität sicherstellen. So erkennt man automatisiert beispielsweise anhand von Frequenzmessungen bevorstehende Leerstandspotentiale. Das, was die 15 Modellstädte entwickeln, ist der OZG-Standard für digitales Leerstandsmanagement.
Am 29. September 2021 hat der Rat der Hansestadt Lüneburg die Teilnahme am Projekt beschlossen. Bürger:innen können Leerstände seit Juni 2022 über diese Internetseite der Hansestadt melden.
Für Lüneburg entstehen insbesondere drei große Vorteile:
- Lüneburg bekommt kostenfrei das zu dem Zeitpunkt beste Leerstands- und Ansiedlungsmanagementsystem und profitiert von der Weiterentwicklung
- Lüneburg kann den Standard als teilnehmende Modellstadt mitgestalten
- Lüneburg bekommt über den Innenstadtbereich ein Netz von Frequenzzählern
Um einen zeitnahen Einsatz zu ermöglichen und sich auf die unterschiedlichen Gegebenheiten der Ortsgrößenklasse einzustellen, erfolgte der Aufbau stufenweise:
- Leerstandserfassung: Quantitative Erfassung von leerstehenden oder leerfallenden Immobilien mit der Möglichkeit Leerstand auch digital zu melden.
- Datenanreicherung (Veredelung): Erfassung aller Gewerbeimmobilien sowie Nutzungsoptionen und weiteren Daten (wie beispielsweise Passantenfrequenzen) sowie Dialog mit der Immobilienwirtschaft, um möglichen Leerstand frühzeitig zu erkennen und Anforderungen zu berücksichtigen.
- Standortentwicklung (Gestaltung): Identifikation von Anbietern und Anforderungsmatching (Verknüpfung von Leerstandsinformationen) zur aktiven und zukunftsfähigen Standortentwicklung.
In der Folge ergibt sich ein innovativer Nachvermietungsprozess. Zudem wird damit nicht nur Leerstandsmanagement bewerkstelligt, sondern die Kommune erhält eine nachhaltige Steuerungsfunktion für ein aktives Ansiedlungsmanagement.

Hansestadt Lüneburg
Nachhaltige Stadtentwicklung
Finn Kubisch
+49 4131 309-3163
E-Mail senden
Oliver Bruns
+49 4131 309-3164
E-Mail senden
Florian Norbisrath
+49 4131 309-3165
E-Mail senden
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren
Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) fördert innovative Konzepte zur Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung in Städten und Gemeinden mit dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Mit der Umsetzung des Programms hat das BMI das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) beauftragt (Internetseite des BBSR zu diesem Thema).
Städte und Gemeinden waren aufgerufen, dem BBSR bis zum 17. September 2021 Projektvorschläge für innovative Konzepte und Handlungsstrategien zur Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung zu unterbreiten.
Maßgeblich hierfür sind laut Projektaufruf nachfolgende Rahmenbedingungen:
Viele Städte und Gemeinden sind von tiefgreifenden Veränderungen in ihren Innenstädten, Stadt- bzw. Ortsteilzentren und Ortskernen betroffen. Das gilt vor allem für einen anhaltenden Strukturwandel im Einzelhandel. Aber auch andere Nutzungen im Tourismus und im Gastgewerbe, von Kultureinrichtungen oder in Kirchen, gewerbliche Nutzungen und die Wohnnutzung sind zum Teil in ihren jetzigen Angebots-und Betriebsformen nur noch gering gefragt oder nicht mehr tragfähig. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschleunigen diese strukturellen Entwicklungen zusätzlich und decken die drängenden Handlungsbedarfe auf. Es bedarf z.T. erheblicher funktionaler, städtebaulicher und immobilienwirtschaftlicher Anpassungen in den Innenstädten, Stadt- und Ortsteilzentren, um die generelle Funktion dieser Handlungsräume für die Gesamtstadt langfristig zu sichern.
Ebenso erfordern veränderte Ansprüche und notwendige Anpassungen, z.B. in den Bereichen Klimaschutz, Mobilität, Wohnen aber auch Freiraum und Grün vielfach eine Neuorientierung in komplexen und sensiblen Stadträumen.
Neben vielen Herausforderungen bietet der anstehende Transformationsprozess aber auch vielfältige Chancen, die es zu erkennen und in guten Lösungen umzusetzen gilt. Eine Neuorientierung von bislang stark einzelhandelsgeprägten Quartieren und Handlungsräumen hin zu neuen multifunktionalen Nutzungen mit einer Vielzahl von Akteuren eröffnet ganz neue Möglichkeitsräume.
Der Bund möchte daher im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ Städte und Gemeinden modellhaft bei der Erarbeitung von innovativen Konzepten und Handlungsstrategien und deren teilweiser Umsetzung fördern. Im Kontext der Strategieentwicklung können somit im Sinne von Reallaboren auch konkrete Einzelmaßnahmen zur Stärkung und Entwicklung der Innenstädte bzw. Zentren unterstützt werden. Ziel ist es, Städte und Gemeinden bei der Bewältigung akuter und auch struktureller Problemlagen („Verödung“) in den Innenstädten, Stadt- und Ortsteilzentren zu unterstützen, indem diese als Identifikationsorte der Kommune zu multifunktionalen, resilienten und kooperativen Orten (weiter)entwickelt werden.
Die geförderten Handlungsstrategien sollen insbesondere auch in experimentellen Verfahren und Formaten – mit sinnvoller Verzahnung zur Bund/Länder-Städtebauförderung – einen Beitrag für eine zukunftsfähige Transformation der Zentren leisten.
Da dies nur als Gemeinschaftsaufgabe aller innenstadtrelevanten öffentlichen und privaten Akteure gelingen kann, sind – ggf. neue – Akteurskooperationen zwischen Bürgern, Eigentümern, Investoren, Verwaltung, Unternehmen und Kreativen, insbesondere auch jungen „Stadtmachern“ zu initiieren bzw. weiterzuentwickeln.
Mit dem Bundesprogramm wird die Initiative des Bundesministeriums des Innern und für Heimat ergänzt, das im Oktober 2020 den „Beirat Innenstadt“ einberufen hat, um bis Sommer 2021 in einem gemeinsamen Arbeitsprozess eine übergreifende, an den derzeitigen Herausforderungen angepasste Innenstadtstrategie zu erarbeiten. Diese soll mit konkreten Handlungsempfehlungen als Hilfestellung für Städte und Gemeinden verstanden werden und bereits bestehende Expertise einbinden. Über das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und die Förderung modellhafter Handlungsstrategien soll auch der Wissenstransfer zwischen den Städten und Gemeinden gestärkt werden.
Die Hansestadt Lüneburg hat am 15. September 2021 beim BMI - Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ihr Interesse an dem Förderprogramm bekundet. Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat am 29. September 2021 beschlossenen, bei Erreichen der nächsten Projektstufe einen Antrag auf Fördermittel aus diesem Programm zu stellen.
Am 30. November 2021 hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) der Hansestadt Lüneburg mitgeteilt, dass die eingereichte Projektskizze positiv bewertet wurde und das BMI entschieden hat, das Vorhaben für das sich nun anschließende formale Zuwendungsverfahren vorzusehen.
Am 25. Februar 2022 wurde ein Antrag mit kalkulierten Projektkosten in Höhe von rund 408.000 Euro gestellt. Die Eigenmittel werden sich bei einer Förderquote von durchschnittlich 80 Prozent auf etwa 81.000 Euro belaufen. Laufzeit des Projektes wird von Frühsommer 2022 bis Sommer 2025 sein.
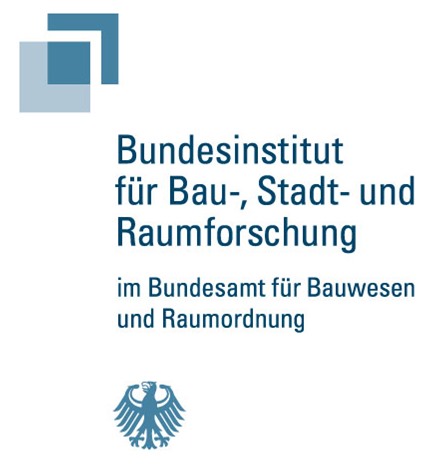
Hansestadt Lüneburg
Nachhaltige Stadtentwicklung
Finn Kubisch
+49 4131 309-3163
E-Mail senden
Oliver Bruns
+49 4131 309-3164
E-Mail senden
Florian Norbisrath
+49 4131 309-3165
E-Mail senden